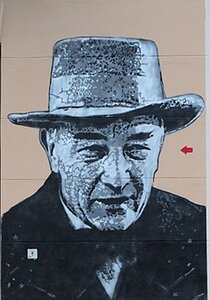I Autor und Werk
Robert Musil * 6. November 1880 in St. Ruprecht bei Klagenfurt; † 15. April 1942 in Genf) war ein österreichischer Schriftsteller und Theaterkritiker.
Zur Biografie siehe Wikipedia, Robert Musil Literatur Museum Klagenfurt und Musil Portal des Robert-Musil-Instituts der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Der Mann ohne Eigenschaften ist das Hauptwerk Robert Musils und wird zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts gezählt. Es erschien ab 1930 in drei Bänden.
Von den 25 bis 30 deutlicher hervortretenden Romangestalten wird hier die Figur des Moosbrugger hervorgehoben, da er ein von Wahnvorstellungen getriebener, inhaftierter Prostituiertenmörder ist. Als Objekt der Medienberichterstattung wird er zugleich in verschiedener Hinsicht Anschauungs- und Streitobjekt, etwa unter medizinisch-psychiatrischen, juristischen, theologischen, bürokratischen und politischen Gesichtspunkten.
II Inhalt
Zitat aus Wikipedia:
Allgemeines
„Kakanien“ nennt Musil im Roman die in überkommenen Strukturen erstarrte, spannungsgeladene und dem Untergang geschäftig entgegentaumelnde k. u. k. Monarchie. Im unmittelbaren Vorfeld des von vielseitiger anfänglicher Begeisterung getragenen Ersten Weltkriegs, auf den der Autor bei der Niederschrift des Romans bereits zurückblickt, entfaltet Musil seinen weitgespannten, zwischen gegebener Wirklichkeit und vorstellbaren Möglichkeiten hin und her pendelnden Reflexionshorizont. Die Titelfigur wird zum „Mann ohne Eigenschaften“, indem sie sich zu nichts ernsthaft bekennen mag und sich jeder Festlegung im eigenen Leben entzieht, um sich für neue Optionen und Konstellationen offen zu halten.
Anklänge und Bezüge zum eigenen Leben, zeitgenössische Medienmeldungen und -berichte sowie Beobachtungen in Gesellschaft, Politik und Kultur waren die wesentlichen Rohstoffe, aus denen Musil sein Hauptwerk formte. Personen seines sozialen Umfelds wurden von ihm oft deutlich erkennbar gespiegelt. Teile des Romanstoffs greifen Zeitungsberichte auf; in weiteren Passagen widmet der Verfasser sich in einer Vielzahl essayartiger Reflexionen der geistigen Situation der Zeit und gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen.
Wie das Romanwerk im Ganzen auf die Besichtigung und Auseinandersetzung Musils mit den gesellschaftlichen und geistigen Strömungen seiner Zeit bezogen ist, so sind es auch die vorkommenden Personen. Sie verkörpern unterschiedliche Menschentypen und stehen für bestimmte Denkmuster. Die 25 bis 30 deutlicher hervortretenden Romangestalten sind laut Schelling durch ein „allseitig nachgiebiges Gespinst von komplizierten, ironisch gebrochenen Neigungen und Abneigungen“ miteinander verbunden.“ Strelka sieht in ihnen aber nicht schemenhaft konstruierte theoretische Typen, sondern darüber hinaus „lebendige Beispiele scharf beobachteter Erfahrungswirklichkeit.” Ihre primären Funktionen im Roman gründen sich für Rasch auf die „inneren Beziehungen zu Ulrich, als Spiegelung und Kontrastierung“.
„Das Entscheidende, weshalb Kapitel zu bilden sind“, heißt es in Musils Tagebuchnotizen, „ist etwas Psychotechnisches: ein kleineres, geschlossenes Thema ist leichter anzupacken, u. ein solcher Rahmen füllt sich leichter mit dem Stoff und seinen Ergänzungen.“ Zugleich können die einzelnen Überschriften Lesern beim Einordnen und Wiederauffinden bestimmter Figuren, Geschehnisse und Reflexionsbögen helfen, was zu Musils Bitte passt, man möge sein Werk zweimal lesen, „im Teil und im Ganzen.“
In 180 Kapitelüberschriften hat Musil die bei Lebzeiten publizierten drei Teile seines Hauptwerks gegliedert: 19 entfallen auf den ersten Teil – „eine Art Einleitung“; 104 auf den zweiten Teil – „Seinesgleichen geschieht“; 38 auf den dritten Teil – „Ins Tausendjährige Reich (Die Verbrecher)“.
Recht und Willkür
Der Fall des Sexualmörders Moosbrugger begleitet die Romanhandlung in einem von Musil bei verschiedenen Gelegenheiten wiederaufgenommenen Seitenstrang, siehe dazu auch die Figurenbeschreibung des Christian Moosbrugger im Figurenlexikon zu Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« (1930/32). Für Albertsen weist Moosbrugger spiegelbildliche Züge zu Ulrich auf: „Moosbrugger ist Mann ohne Eigenschaften, weil er alle Eigenschaften hat und ist, Ulrich ist Mann ohne Eigenschaften, weil er weiß, er könnte jede beliebige annehmen. Moosbrugger ist »M. o. E.« im Indikativ, Ulrich »M. o. E.« im Konjunktiv, wirklicher Möglichkeitsmensch.“
Beiden gemeinsam ist ein außerhalb bzw neben der Gesellschaft Stehen, wobei Moosbruggers Verhalten aber in sozialer und psychischer Hinsicht ins Extreme ausschlägt. Musil schildert dessen Denken und Erleben wie das von Ulrich oft jeweils aus der Binnensicht der Person. Im Gegensatz zu Ulrich tut sich Moosbrugger mit dem gängigen Sprachgebrauch schwer. Während seiner Haft in der Einzelzelle empfindet er, dass es die Sprache der Justizvertreter ist, die sie Macht über ihn ausüben lässt.
Menges betrachtet Moosbruggers „Kampf gegen die Irritationen von Innen und Außen“ als ein Ringen um Autonomie. „Um dieses Zieles willen zieht er sich in die autistische Einsamkeit zurück oder greift, wenn dies nichts fruchtet, zum Mittel der Gewalt. […] Er ist nicht nur das Monstrum, das alle Welt in ihm sieht, er will es auch sein.“ Moosbrugger verhalte sich wie der typische Außenseiter, „dem alle Bestätigung versagt wurde: wenigstens hier will er das verspüren, was er in seinem gewöhnlichen Lebensalltag weder erhielt noch erhalten wollte, weil es dort gleich als Eingriff in seine Autonomie erschien: Bestätigung von Außen. Moosbrugger stellt sich vorbehaltlos in das grelle Licht seiner Tat, die überall Entsetzen erregt.“
Laut Corino hat Musil bei der Schilderung von Moosbruggers Verurteilung zum Tode teils wortwörtlich die Äußerungen des realen Vorbilds Christian Voigt übernommen:
„Als der Vorsitzende das Gutachten vorlas, das ihn als verantwortlich erklärte, erhob sich Moosbrugger und tat dem Gerichtshof kund: «Ich bin damit zufrieden und habe meinen Zweck erreicht.» Spöttischer Unglaube in den Augen ringsumher antwortete ihm, und er fügte zornig hinzu: «Dadurch, daß ich die Anklage erzwungen habe, bin ich mit dem Beweisverfahren zufrieden! […] Ich bin damit zufrieden, wenn ich Ihnen auch gestehen muß, daß Sie einen Irrsinnigen verurteilt haben.»“
In Kapitel 20 „Berührung der Wirklichkeit. Ungeachtet des Fehlens von Eigenschaften benimmt sich Ulrich tatkräftig und feurig“ findet sich der Romanheld auf Empfehlungsschreiben seines Vaters in der Wiener Hofburg bei Graf Stallburg ein, um sich für eine mögliche Verwendung begutachten zu lassen. Der Graf ist ihm gewogen, kommt aber leicht aus dem Tritt, als Ulrich ihn ersucht, sich für eine Begnadigung Moosbruggers einzusetzen.
„Es war eine Entgleisung, diesem Mann eine Erörterung zuzumuten, wie sie Leute, denen an geistigen Umtrieben gelegen ist, oft ganz zwecklos auf sich nehmen. So ein paar Worte, richtig eingestreut, können fruchtbar wie lockere Gartenerde sein, aber an diesem Ort wirkten sie wie ein Häuflein Erde, das einer versehentlich an den Schuhen ins Zimmer getragen hat. Aber nun, da Graf Stallburg seine Verlegenheit bemerkte, bewies er ihm wahrhaft großes Wohlwollen. «Ja, ja, ich erinnere mich […] und Sie sagen also, daß das ein Geisteskranker sei, und möchten diesem Menschen helfen?» «Er kann nichts dafür.» «Ja, das sind immer besonders unangenehme Fälle.» Graf Stallburg schien sehr unter ihren Schwierigkeiten zu leiden. Er sah Ulrich hoffnungslos an und fragte ihn, als sei doch nichts anderes zu erwarten, ob Moosbrugger schon endgültig abgeurteilt sei. Ulrich mußte verneinen. «Ach, nun sehen Sie,» fuhr er erleichtert fort, «dann hat es ja noch Zeit,» und er begann von «Papa» zu sprechen, den Fall Moosbrugger in freundlicher Unklarheit zurücklassend.“
In Kapitel 111 „Es gibt für Juristen keine halbverrückten Menschen“ wird der Fall Moosbrugger zum Anlass kontroverser Bewertungen im Justizausschuss, dem Ulrichs Vater angehört. Dessen Widerpart in der Sache ist Professor Schwung – „vielleicht weil er seit vierzig Jahren der Freund und Kollege des alten Herrn war, was schließlich doch einmal zu einem heftigen Gegensatz führen muß“. Dabei gelte es zu berücksichtigen, heißt es im Roman, dass der Jurist aus logischen Gründen „in betreff derselbigen Tat niemals ein Mischungsverhältnis zweier Zustände zugeben dürfe“.
„Und weil beide Gelehrte von der Würde des Rechts in gleichem Maße überzeugt waren und keiner die Mehrheit des Ausschusses auf seine Seite bringen konnte, warfen sie einander zuerst Irrtum, dann aber in rascher Aufeinanderfolge Unlogik, gewolltes Mißverstehen und mangelnde Idealität vor.“
Ulrichs Vater publizierte dazu zwei Streitschriften, die Schwung wiederum in einem Juristen-Fachblatt kritisierte.
„Es kamen in diesen Streitschriften viele Und und Oder vor, denn es mußte die Frage «bereinigt» werden, ob man die beiden Auffassungen durch ein Und verbinden könne oder durch ein Oder trennen müsse. Und als nach langer Pause der Ausschuß wieder einen Schoß bildete, hatte sich in diesem bereits eine Und- und eine Oderpartei getrennt. Außerdem gab es aber auch eine Partei, die sich für den einfachen Vorschlag einsetzte, das Maß der Zurechnung und Unzurechnungsfähigkeit im gleichen Verhältnis steigen und fallen zu lassen, wie die Größe des Aufwands an psychischer Kraft steige und falle, die unter den gegebenen Krankheitsumständen zur Selbstbeherrschung hinreichen würde. […] Es ist schwer, der Gerechtigkeit in Kürze Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Kommission bestand aus ungefähr zwanzig Gelehrten, denen es möglich war, einige tausend Standpunkte zueinander einzunehmen, wie sich leicht nachrechnen läßt. Die Gesetze, die verbessert werden sollten, standen seit dem Jahre 1852 in Anwendung, es handelte sich also überdies um eine sehr dauerhafte Sache, die man nicht leichtfertig durch eine andere ersetzen darf. Und überhaupt kann die ruhende Einrichtung des Rechts nicht allen Gedankensprüngen der jeweilig herrschenden Geistesmode folgen, – wie ein Teilnehmer richtig bemerkte.“
III Printausgaben
Der Mann ohne Eigenschaften. Band 1: Rowohlt, Berlin 1930(1074 S.); Band 2: Rowohlt, Berlin 1933 (605 S.); Band 3: Rowohlt, Lausanne 1943 (462 S.).
Der Mann ohne Eigenschaften. In: Gesammelte Werke, Band 1. Hg. von Adolf Frisé. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1978, ISBN 3-498-04255-6 (2154 S.).
Der Mann ohne Eigenschaften. Hg. von Adolf Frisé. Band 1: Erstes und zweites Buch. Neu durchges. und verb. Ausg. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1978, ISBN 3-499-13462-4 (TB Rororo 13462, 1040 S.). Band 2: Aus dem Nachlass. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1978, ISBN 3-499-13463-2 (TB Rororo 13463, S. 1045–2159).
Der Mann ohne Eigenschaften. 4 Bände (im Rahmen einer Musil-Gesamtausgabe in zwölf Bänden), Jung und Jung, Salzburg 2016–2018.
IV Online-Ausgaben
Textausgabe bei Projekt Gutenberg-DE
Hier können Sie Musils Text in der für die Gesamtausgabe bei Jung und Jung neu konstituierten Form lesen und sich über die Varianten gegenüber bisherigen Ausgaben sowie über Vorabdrucke einzelner Kapitel informieren. Im gesamten Portal weist Sie das Icon jeweils auf das Vorhandensein von zugänglichem Textmaterial hin.
V Adaptionen
Hörbuch und Hörspiel
Der Mann ohne Eigenschaften. Gelesen von Wolfram Berger. Regie: Hans Drawe. 2 MP3-CDs (2140 Min.). Zweitausendeins, Frankfurt 2004, ISBN 3-86150-652-1.
Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Hörspiel in 20 Teilen. Mit Manfred Zapatka, Ulrich Matthes, Susanne Wolff, Wolf Bachofner, Ulli Maier, Angela Winkler, Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Wolfgang Hübsch, Sunnyi Melles, Achim Buch, Nadine Geyersbach, Michael Rotschopf, Peter Fricke, Dorothee Hartinger, Jens Wawrczeck, Gottfried Breitfuß, Oliver Stern, Felix von Manteuffel / Konzept: Katarina Agathos, Herbert Kapfer / Skript: Katarina Agathos, Klaus Buhlert, Herbert Kapfer / Regie: Klaus Buhlert / Wissenschaftliche Beratung: Walter Fanta / BR Hörspiel und Medienkunst 2004. Als Podcast/Download im BR Hörspiel Pool. Hörbuchedition: Buch (698 S.) und 20 CDs. Hg. von Katharina Agathos. Bayerischer Rundfunk. der Hörverlag, München 2004, ISBN 3-89940-416-5.
Der Fall Moosbrugger
Es handelt sich wohl um eine Adaption, wenn 2020 im Verlag Steidl in der Reihe Steidl nocturnes ein 122 Seiten starkes Büchlein von Auszügen aus Der Mann ohne Eigenschaften unter dem Titel: Robert Musil Der Fall Moosbrugger ISBN: 978-3-95829-780-7 erscheint.
Das Literaturhaus Wien widmet sich in einem Beitrag von Hannes Gschwandtner vom Jänner 2021 zunächst der Geschichte der MoE-Kürzungen und attestiert sodann, dass (Zitat):
sich das aktuelle Vorhaben des Steidl-Verlags indes als deutlich musilfreundlicher erweist. Der Fall Moosbrugger lädt tatsächlich dazu ein, den Autor wieder oder neu zu entdecken: Auch hier wird eingangs darauf verwiesen, dass die „essayistische Struktur und der mäandernde Erzählverlauf“ des Mann ohne Eigenschaften „viele Leser vor Schwierigkeiten“ gestellt habe, „so dass sie nach hundert oder zweihundert Seiten häufig die Waffen streckten“. Der Herausgeber hat deshalb den „vielleicht handlungsstärkste[n], gewiss de[n] seelisch abgründigste[n] Motivstrang“ aus den weit über 100 Kapiteln des Mann ohne Eigenschaften herauspräpariert ... Der Fall Moosbrugger versammelt insgesamt neun Kapitel aus Musils Roman, die sich mehrheitlich dem Schicksal des Frauenmörders widmen: seiner tragischen Vorgeschichte als vagabundierender Handwerker, einem Leben voll passiver wie aktiver Gewalterfahrung, dem brutalen Mord an einer Prostituierten, aber auch dem Gerichtsprozess, den Musil als exemplarisches Medienereignis der Moderne inszeniert...
VI Hinweise zu dieser Webseite
- Die Zitate aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und aus dem Literaturhaus Wien - Beitrag Gschwandner's (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.
- Es besteht die Möglichkeit, eine Textausgabe des Werks auf Gutenberg.de und Musil online zu lesen.
- Personenbezogene Daten ergeben sich aus der Literaturbeschreibung sowie aus dem Bekanntheitsgrad des Autors und seines Werks.