I Kunstwerk
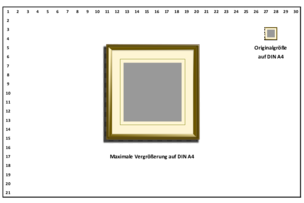
Nein, in diesem Fall geht es nicht um die Symphonie C-Dur Köchelverzeichnis 551, die Wolfgang Amadeus Mozart im Sommer 1788 in Wien komponierte. Nach der Alten Mozart-Ausgabe trägt die Symphonie die Nummer 41. Es ist Mozarts letzte Symphonie. Ihr Beiname Jupiter-Symphonie (später auch Jupitersymphonie) tauchte erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts auf.
Es geht vielmehr um das mehr als 200 Jahre später von der Künstlerin A***** G***** geschaffene Gemälde Mozart Symphonie No 41 (Acrylfarbe auf Leinen, 120 x 160 Zentimeter). Sie gestattete der P***** GmbH, die ein Hotel in Wien betreibt, in deren Hotelräumlichkeiten eine befristete Verkaufsausstellung ihrer Gemälde zu veranstalten. Für jedes verkaufte Gemälde sollte die Beklagte eine Provision erhalten. Die Ausstellung fand vom 25. 6. bis 25. 9. 2007 statt. Während dieser Zeit konnte A***** G***** keines der Gemälde verkaufen. Danach wurde vereinbart, dass die Gemälde gegen einen monatlichen Betrag der P***** GmbH von 83 EUR weiter hängen bleiben dürfen. Die erste Monatsrate erhielt A***** G***** in bar ausbezahlt; als sie die zweite Monatsrate verlangte und auf das Monatsende verwiesen wurde, hängte A***** G***** ihre Gemälde ab und nahm sie mit. Während der Ausstellung wurden Lichtbilder von den Räumlichkeiten des Hotels der P***** GmbH angefertigt und in weiterer Folge - ohne Zustimmung der A***** G***** - auf die Homepage des Hotels gestellt. Auf zwei von zehn dieser Lichtbilder ist das eingangs näher beschriebene Gemälde der A***** G***** im Hintergrund an der Wand hängend zu sehen.
Und es geht um Winzigkeiten und Formate, wie in der Grafik - bezogen auf ein DIN A4 Blatt (297 x 210mm) - mit den Bilderrahmen rechts oben in ursprünglicher Größe und vergrößert in der Mitte - ungefähr - darzustellen versucht wird, zumal das Bild Mozart Symphonie No 41 nicht verfügbar ist.
II Schlagworte und Leitsatz
- Privatrecht – Urheberrecht – Bildkunst – Internet
- Eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung eines Werks liegt schon dann vor, wenn eine sinnliche Werkwiedergabe - wie hier - dadurch möglich ist, dass ein auf eine Website eingestelltes Lichtbild, auf dem das mit abgebildete Werk infolge seiner geringen Größe zunächst nicht zu erkennen ist, mittels Mausklick vergrößert dargestellt werden kann.
III Parteien
Die Künstlerin A***** G***** ist die Klägerin. Die P***** GmbH, die ein Hotel in Wien betreibt und zwei Lichtbilder mit dem Gemälde im Hintergrund an der Wand hängend auf die Hompage des Hotels gestellt hat, ist beklagte Partei..
IV Sachverhalt
Im Sicherungsverfahren beantragte die Klägerin, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung aufzutragen, es bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils zu unterlassen, das in der Beil ./A abgebildete Werk zu vervielfältigen oder zu verbreiten, insbesondere durch Einstellung von Bildern des Werks auf der Homepage der Beklagten. Die Beklagte verwende ohne Zustimmung der Klägerin Lichtbilder eines Gemäldes der Klägerin für eigene Werbezwecke und greife damit in allein der Urheberin zustehende Verwertungsrechte (§§ 14 - 18a UrhG) ein.
Die Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrags. Es liege kein Werkgenuss durch Vervielfältigung des Originals vor, weil nur solche Handlungen als Vervielfältigung im urheberrechtlichen Sinn zu beurteilen seien, die in irgendeiner Form die Verwertungs-möglichkeit des Urhebers beeinträchtigen könnten. Der Klägerin sei weder ein rechtlicher noch ein wirtschaftlicher Nachteil entstanden, sondern es liege sogar in ihrem Interesse, wenn ihre Werke einem größeren Personenkreis bekannt würden.
Der Oberste Gerichtshof entschied am 23.02.2010 zu 4 Ob 208/09f im Sicherungsverfahren, dass es Voraussetzung einer an die Zustimmung des Urhebers geknüpften Werkverwertung in Form der Vervielfältigung, Verbreitung oder Zurverfügungstellung ist, dass das Werk in der verwerteten Form annähernd den sinnlichen Eindruck des Originalwerks in seinen wesentlichen schöpferischen Zügen vermittelt, mag es auch infolge Bearbeitung nicht dessen Originalgröße aufweisen. Diese Voraussetzung liegt nicht vor, wenn ein Gemälde (Acryl auf Leinen, Originalgröße 120 cm x 160 cm) auf im Internetauftritt eines Hotels eingestellten Fotografien der Hotelräumlichkeiten als Wandschmuck im Hintergrund der abgebildeten Räume in einer Größe von nicht einmal einem Hundertstel der Originalgröße (bei Wiedergabe des Bildschirminhalts im Format A 4) sichtbar ist. Bei dieser Sachlage bedarf es keiner näheren Prüfung, ob es im österreichischen Urheberrecht eine freie Werknutzung geschützter Werke als unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Bearbeitung oder öffentlichen Wiedergabe (vgl § 57 dUrhG) gibt (abl M. Walter, MR 1987, 13).
Mit dem Sicherungsverfahren war die gegenständliche Rechtssache jedoch noch nicht abgeschlossen.
V Gang des Verfahrens
Standpunkt der Klägerin: Im Hauptverfahren begehrt die Klägerin die Unterlassung der Verwertung, insbesondere der Vervielfältigung oder Verbreitung, ihres Bildes Mozart Symphonie No 41, insbesondere durch Einstellung von Bildern des Werks auf der Homepage der Beklagten, sowie die Entfernung sämtlicher das Werk der Klägerin zeigender Lichtbilder von dieser Homepage und die Zahlung eines angemessenen Entgelts. Sie bringt dazu - ergänzend zum Sicherungsverfahren - vor, die Beklagte habe jene Bilder von Hotelzimmern, die den Anlass zur Klage gegeben haben, mittlerweile von ihrer Homepage entfernt. Wie die Klägerin aber an Hand von - in einem Internetarchiv aufgefundenen - früheren Versionen der Website der Beklagten festgestellt habe, sei eine Vergrößerung der auf der Homepage der Beklagten früher eingestellten (beanstandeten) Bilder von Hotelzimmern durch Anklicken mit der Maus möglich gewesen; diesfalls seien die Bilder in einem sich neu öffnenden Fenster vergrößert dargestellt worden. Dieser Vorgang habe dazu geführt, dass auch das an der Wand eines der abgebildeten Hotelzimmer aufgehängte Gemälde der Klägerin bei einem Ausdruck der Seite im Format A 4 in einer Größe von etwa 11 cm x 10 cm erkennbar gewesen sei.
Anmerkung des Verfassers: Im Gegensatz zum Sicherungsverfahren war daher im Hauptverfahren nicht mehr von einem winzigen Bildausschnitt von nicht einmal einem Hundertstel der Originalgröße, sondern Hauptverfahren – zumindest bei Vergrößerung durch Anklicken – von mehr als der Hälfte eines Din A4 Blattes auszugehen.
Das Erstgericht hat das Klagebegehren abgewiesen. Es ging von der - vom Berufungsgericht nicht übernommenen - Feststellung aus, dass bei Aufruf der Website das Gemälde der Klägerin (bei einer Wiedergabe des Bildschirminhalts im Format A 4) höchstens in einer Größe von 1,1 cm x 1,5 cm zu erkennen sei, und führte in rechtlicher Hinsicht - der Entscheidung 4 Ob 208/09f folgend - aus, dass unter diesen Umständen keine an die Zustimmung des Urhebers geknüpfte Werkverwertung in Form der Vervielfältigung, Verbreitung oder Zurverfügungstellung vorliege; es fehle nämlich an der Voraussetzung, dass das Werk in der verwerteten Form annähernd den sinnlichen Eindruck des Originalwerks in seinen wesentlichen schöpferischen Zügen vermittle.
Das Berufungsgerichtbestätigte dieses Urteil; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands zwar 4.000 EUR, nicht aber 30.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zu urheberrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit veröffentlichten Fotos, die die Einrichtung allgemein zugänglicher Räume wiedergeben und auf denen bildnerische Werke im Hintergrund mit abgebildet sind, fehle. Das Berufungsgericht hat das Vorbringen der Klägerin im Hauptverfahren seiner rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt, weil es durch Urkunden belegt und von der Beklagten nicht substantiiert bestritten worden sei und damit als zugestanden gemäß § 267 ZPO anzusehen sei. Habe man die Lichtbilder auf der Homepage der Beklagten nach Vergrößerung durch Anklicken betrachtet, sei das Gemälde der Klägerin im Hintergrund der Hotelräumlichkeiten deutlich erkennbar gewesen. Dennoch könne von einer mangels Zustimmung der Klägerin unzulässigen Vervielfältigung ihres Werks schon deshalb keine Rede sein, weil mit den Fotos keine wirtschaftlich verwertbare Kopie des Originalbildes hergestellt, sondern das Originalgemälde nur als Wandschmuck der fotografierten Hotelräumlichkeiten mit abgebildet worden sei. Bei Auslegung des Begriffs der Vervielfältigung sei nicht ausschließlich auf die mechanischen Zusammenhänge abzustellen, sondern stets auch auf Sinn und Zweck des Vervielfältigungsrechts Bedacht zu nehmen. Relevant seien deshalb nur Vervielfältigungen, die die Verwertungsmöglichkeit des Urhebers in irgendeiner Form beeinträchtigten. Dem Vorbringen der Klägerin sei nicht zu entnehmen, inwieweit sie die Verwertungsmöglichkeit ihres Bildes durch die von der Beklagten verwendeten Fotos beeinträchtigt sehe. Auch das Zurverfügungstellungsrecht der Klägerin nach § 18a UrhG sei im vorliegenden Fall nicht verletzt, weil die Beklagte in ihrem Internetauftritt kein Werk der Klägerin für sich allein, also als Hauptgegenstand der Abbildung, zum interaktiven Abruf eingegliedert habe, sondern das Werk der Klägerin auf den veröffentlichten Fotos, die in erster Linie die Räumlichkeiten des Hotels zeigten, lediglich im Hintergrund zu sehen sei.
VI Rechtliche Beurteilung des Höchstgerichtes
Die Revision ist zulässig, aber nicht berechtigt.
1. Auch in dritter Instanz ist von jenen Feststellungen auszugehen, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Damit hat sich der Sachverhalt gegenüber dem Sicherungsverfahren in jenem Punkt geändert, der dort noch für die Entscheidung maßgeblich war (fehlende Erkennbarkeit des Gemäldes der Klägerin auf den in die Homepage eingegliederten Fotos).
2. Eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung eines Werks liegt schon dann vor, wenn eine sinnliche Werkwiedergabe - wie hier - dadurch möglich ist, dass ein auf eine Website eingestelltes Lichtbild, auf dem das mit abgebildete Werk infolge seiner geringen Größe zunächst nicht zu erkennen ist, mittels Mausklick vergrößert dargestellt werden kann (so auch Walter, Entscheidungsbesprechung MR 2010, 206).
3.1. Zwar wurde in der Entscheidung 4 Ob 208/09f bei der Frage nach Sinn und Zweck der dem Urheber eingeräumten exklusiven Nutzungsrechte der wirtschaftliche Aspekt in den Vordergrund gestellt und ausgeführt, dass dem Urheber ein Entgelt für solche Nutzungshandlungen zufließen soll, die einen Werkgenuss ermöglichen. Es ist aber in Anschluss an die Kritik von Walter (aaO) und Reis (Zur Rechtfertigung 'geringfügiger' Eingriffe in das Urheberrecht, MR 2011, 22) klarzustellen, dass auch die Kontrolle über die Nutzung seines Werks durch den Urheber in den Schutzbereich der dem Urheber eingeräumten Verwertungsrechte fällt. Das Gesetz will dem Urheber die Möglichkeit einräumen, die Art und Weise der Werknutzung unter Berücksichtigung unter Umständen auch persönlichkeitsrechtlicher Anliegen steuern zu können. Es greift daher zu kurz, wenn das Berufungsgericht eine unzulässige Vervielfältigungshandlung allein deshalb verneint, weil mit den in die Website eingestellten Fotos keine wirtschaftlich verwertbare Kopie des Originalbildes hergestellt worden sei. Vielmehr ist der festgestellte Sachverhalt als Eingriff in urheberrechtliche Verwertungsrechte zu beurteilen.
4. Angesichts der von der Beklagten somit zu verantwortenden Vervielfältigungshandlung gewinnt die in der Klagebeantwortung erhobene rechtfertigende Einrede des Beklagten an Bedeutung, der Klägerin sei vor und auch während der Ausstellung ihrer Bilder im Hotel der Beklagten bekannt gewesen, dass immer wieder Aufnahmen von den Hotelräumlichkeiten auch zum Zweck der Bewerbung des Hotels gemacht würden; derartige Aufnahmen seien auch in Anwesenheit der Klägerin, etwa am Beginn der Ausstellung ihrer Bilder, nicht nur mit schlüssiger, sondern mit ausdrücklicher Akzeptanz der Klägerin gemacht worden. Diesem Vorbringen der Beklagten hat die Klägerin nicht widersprochen, weshalb dieser Sachverhalt der Entscheidung gemäß § 267 Abs 1 ZPO zugrunde zu legen ist (vgl RIS-Justiz RS0039927, RS0083785, RS0039941 [T2]).
5.1. Der Urheber kann zwar auf sein Urheberrecht in seiner Gesamtheit nicht verzichten, er kann aber durch Erklärung seine Zustimmung zu bestimmten Nutzungshandlungen erteilen (Walter, Österreichisches Urheberrecht I, 770).
5.2. Letzteres entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Senats zum Verzicht auf die Geltendmachung des Schutzrechts nach § 78 UrhG (RIS-Justiz RS0078179), wobei der Schutz nur soweit entfällt, wie die Zustimmung reicht. Es ist deshalb in jedem Einzelfall zu prüfen, für welchen Zweck und in welchem Zusammenhang die Zustimmung erteilt wurde (vgl 4 Ob 211/03p = SZ 2003/169 mwN; RIS-Justiz RS0078128).
5.3. Anders als bei der rechtsgeschäftlichen Einräumung eines entsprechenden Nutzungsrechts genügt es für eine (schlichte) Einwilligung des Berechtigten in eine Nutzungshandlung, dass seinem (auch nur schlüssigen) Verhalten die objektive Erklärung entnommen werden kann, er sei mit der Nutzung seines Werks einverstanden (vgl BGH 29. 4. 2010, I ZR 69/08 - Vorschaubilder Rn 33; zur schlüssigen Annahme eines Nutzungsangebots des Rechteinhabers durch dessen Ausübung vgl Walter aaO 770 f). Die Einwilligung bewirkt, dass die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs in ein ausschließliches Verwertungsrecht wegen Vorliegens einer schlichten Einwilligung des Berechtigten ausgeschlossen ist.
6.1. Auf der Grundlage des in Punkt 4. näher beschriebenen Sachverhalts liegen die Voraussetzungen einer solchen (schlichten) Einwilligung der Klägerin in die später mit ihrer Klageführung beanstandete Rechtsverletzung vor.
6.2. War der Klägerin nämlich bekannt, dass die Beklagte immer wieder Aufnahmen ihrer Hotelräumlichkeiten auch zum Zweck der Bewerbung des Hotels macht und hat sie solche Aufnahmen in ihrer Anwesenheit auch am Beginn der Ausstellung ihrer Gemälde ohne Widerspruch geduldet, hat sie dadurch bei der Beklagten ein schutzwürdiges Vertrauen dahingehend geweckt, es könne erwartet werden, dass die Klägerin gegenüber der Beklagten ein Werbeverbot mit solchen Fotos von Hotelräumlichkeiten ausspricht, auf dem auch ihre Gemälde erkennbar sind, falls sie mit einer Veröffentlichung solcher Fotos nicht einverstanden ist.
6.3. Daraus ergibt sich, dass das Verhalten der Klägerin im Zusammenhang mit der Herstellung von Fotos der Hotelräumlichkeiten anlässlich der Ausstellungseröffnung aus Sicht der Beklagten objektiv als stillschweigendes Einverständnis damit verstanden werden konnte, dass Abbildungen der Werke der Klägerin im Zuge von Werbemaßnahmen üblichen Umfangs für Zwecke der Hotelwerbung genutzt werden dürfen. Die Einstellung der beanstandeten Fotos auf die Homepage der Beklagten hält sich im Rahmen dieser Zustimmung, weshalb die Beklagte insoweit nicht rechtswidrig gehandelt hat. Das Klagebegehren erweist sich damit aus diesem Grund als unberechtigt.
6.4. Diesem Ergebnis steht die Feststellung des Erstgerichts nicht entgegen, wonach die Klägerin niemals ihre Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer Bilder auf der Homepage des Hotels erteilt hat, weil das Erstgericht damit erkennbar nur eine Aussage über eine ausdrückliche Zustimmung der Klägerin getroffen hat.
6.5. Nur ergänzend ist zu bemerken, dass die Einbringung der Klage wohl als Widerruf der Einwilligung der Klägerin in die nunmehr beanstandete Werknutzung zu deuten ist. Dies ändert aber nichts am Verfahrensergebnis, hat doch die Beklagte auf die Klage mit dem Entfernen der beanstandeten Fotos von ihrer Homepage reagiert.
VII Kommentare
Kommentar der Lehre
Handig führt in OGH: Zur urheberrechtlichen Relevanz nicht ganz so „winziger Wiedergaben“ in jusIT 2011/ 100, 216 aus, dass dies (Zitat)
für Fotografen und die Nutzer von Fotografien bedeutet, dass in Österreich selbst „unwesentliches Beiwerk“ (iSd § 57 dUrhG) nur dann unbeachtlich ist, falls dessen Wiedergabe wirklich „winzig“ im Sinne von „nicht erkennbar“ ist (vgl OGH 4 Ob 208/09 f, RN 4.3., Mozart Symphonie No 41 ). Dies ist wesentlich, weil bei einer Vielzahl von Fotografien zwangsläufig viele Gegenstände ebenfalls aufgenommen werden, denen Werk-charakter zukommen kann. Freilich werden derartige Ausschließungsrechte idR nicht durchgesetzt, trotzdem bleibt für die Fotografen und die Nutzer von Fotografien ein Restrisiko bestehen.
Favorartis Kommentar
Möglicherweise ist die klagende Partei mit dem Versuch der Durchsetzung ihrer Rechte einen Schritt zu weit gegangen, da derartige Rechte idR nicht durchgesetzt werden. War es Im Provisiorialverfahren die Winzigkeit, die die klagende Partei scheitern ließ, so war es im Hauptverfahren ihr objektiv zu verstehendes stillschweigendes Einverständnis damit, dass Abbildungen ihrer Werke im Zuge von Werbemaßnahmen üblichen Umfangs für Zwecke der Hotelwerbung genutzt werden dürfen. ⇒Kein Favor artis für die klagende Partei !
VIII Hinweise zu dieser Webseite
- Der Text der Entscheidung ist dem RIS (Open Government Data) entnommen.
- Personenbezogene Daten, die über die Veröffentlichung im RIS hinausgehen, sind auf der Webseite nicht enthalten.
- Das angeführte Zitat aus jusIT (mit Quellenangabe) erfolgt im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.
