I Autor und Werk
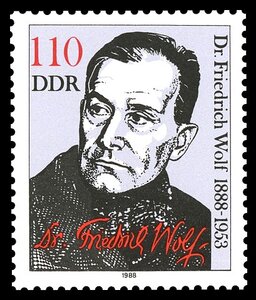
Zitat aus dem Begleittext von Heide Soltau zur Hörfunksendung des WDR in der Sendereihe Zeitzeichen am 06.09.2014 unter dem Titel: 06.09.1929 - Uraufführung „Cyankali“ von Friedrich Wolf:
Mit tosenden, minutenlangen "Applaussalven" geht am 6. September 1929 die Uraufführung von "Cyankali" über die Bühne des Lessingtheaters in Berlin. Nieder mit dem Paragraphen 218 skandieren Zuschauer auf den Rängen. Autor des Stücks ist der Arzt und Schriftsteller Friedrich Wolf.
Der überzeugte Kommunist prangert darin die Zustände in Deutschland an, die jährlich 800.000 Mütter zu Verbrechern machen und die mehr als 10.000 von ihnen mit dem Leben bezahlen. "Cyankali" löst eine breite Diskussion im In- und Ausland aus.
1932 wird Wolf wegen gewerbsmäßiger Abtreibung verhaftet, kommt aber aufgrund von Massenprotesten bald wieder frei. Nach dem Zweiten Weltkrieg graben Dramaturgen in Stuttgart das Stück wieder aus, als in der Bundesrepublik Mitte der 70er Jahre über den Paragraphen 218 gestritten wird.
Siehe dazu die Webseite des WDR mit der Möglichkeit, die knapp 15minütige Sendung nachzuhören.
II Handlung
Übernommen aus Wikipedia:
Die zwanzigjährige Hete Fent erwartet ein Kind von ihrem Freund Paul. Obwohl die beiden nicht verheiratet sind und Hete noch bei ihrer Mutter (Mutter Fent) wohnt, wünschen sich beide das Kind. Die Voraussetzungen scheinen günstig, da die jungen Eltern ein gesichertes Einkommen haben. Hete ist Reinigungskraft in den Büros der Werksdirektion, Paul gelernter Heizer, der als Spezialarbeiter an den Hochöfen arbeitet. Da Paul im Werk geschätzt und beliebt ist, wird er zusätzlich als Vertrauensmann in die Kantinenkommission des Werkes gewählt.
Doch wegen Tarifstreitigkeiten kommt es unerwartet zur betrieblichen Aussperrung der Arbeiter. Da auch die Hochöfen und die Büros stillgelegt werden, stehen Paul und Hete auf einen Schlag ohne Einkommen da. Kaum jemand im Arbeiterviertel kann sich nun noch Lebensmittel leisten. Eine befreundete Nachbarin und mehrfache Mutter stürzt sich aus Verzweiflung über ihre erneute Schwangerschaft in dieser Notlage aus dem Fenster in den Tod. Hete erkennt, dass sie und Paul ohne Einkommen das Neugeborene nicht werden ernähren können. Obwohl sie das Kind gerne bekommen würde, sieht sie nun keinen anderen Ausweg als eine Abtreibung. In der Hoffnung auf Hilfe wendet sich Hete an den Hausverwalter Prosnik, welcher ein altes Instrument für Abtreibungen besitzt. Dieser willigt auch ein, es ihr zu überlassen, versucht sie aber zu erpressen, indem er als Gegenleistung Geschlechtsverkehr verlangt. In dieser Situation kommt Paul hinzu. Er entwendet Prosnik das Instrument und nimmt es an sich.
Einige Zeit später sitzen Hete, Mutter Fent und einige andere Hausbewohner am Küchentisch bei Familie Fent und leiden aufgrund der langen Aussperrung bitteren Hunger. Überraschend kommen Paul und sein Freund Max hinzu, die in die Werkskantine eingebrochen sind und Lebensmittel gestohlen haben. Diese verteilen sie unter den hungrigen Hausbewohnern. Nach einem kurzen Moment der Freude stellt sich jedoch heraus, dass Paul und Max wegen des Einbruchs schon von der Polizei verfolgt werden. Sie müssen fliehen und untertauchen. Hete ist nun völlig auf sich gestellt. Sie geht zu dem Arzt Dr. Möller. Dieser entpuppt sich als bestechlich. Er stellt einer gesunden reichen Frau ein Abtreibungsattest über eine medizinische Indikation aus. Da Hete über kein Geld verfügt, um den Arzt bestechen zu können, verweigert er ihr nicht nur jegliche Hilfe, sondern macht ihr zudem schwere Vorwürfe wegen ihres Ansinnens und hält ihr die Strafandrohung des Strafgesetzbuches wörtlich vor.
Paul und Max sind zwischenzeitlich im Kiosk des befreundeten Zeitschriftenhändlers Kuckuck untergekommen. Dort soll Paul auf Hetes Bitten hin das Kind mit dem entwendeten Instrument des Hausverwalters Prosnik abtreiben. Da er dies aber im entscheidenden Moment nicht über sich bringt, unternimmt Hete den Abtreibungsversuch selbst. Sie verletzt sich dabei und erkrankt in der Folge an Kindbettfieber. Einen Arzt kann sie jedoch nicht aufsuchen, da dieser sie wegen der versuchten illegalen Abtreibung bei der Polizei melden könnte. Hetes Verzweiflung wächst. In ihrer Not sucht sie eine Lohnabtreiberin auf und fleht sie an, den Abort vorzunehmen. Als die Abtreiberin jedoch bemerkt, dass Hetes schlechter Gesundheitszustand von einem vorherigen Abtreibungsversuch herrührt, bekommt sie Angst, in die Sache mit hineingezogen zu werden, und setzt das Mädchen vor die Tür. In einem Anflug von Mitleid rät sie Hete noch zur Selbstabtreibung mit wenigen Tropfen Zyankali aus einem Fläschchen, das sie der Schwangeren mitgibt. Hete flüchtet nun zurück zu ihrer Mutter. Diese erklärt sich aus Mutterliebe bereit, ihr bei der Abtreibung zu helfen. Da beide Frauen die Dosierung falsch einschätzen, nimmt Hete eine Überdosis ein. Der Abort gelingt zwar, aber der tödlich vergifteten Hete kann der herbeigerufene Dr. Möller nicht mehr helfen. Vielmehr zeigt der Arzt sie und ihre Mutter wegen der Abtreibung bei der Polizei an. Inzwischen ist auch Paul verhaftet worden. Am Ende des Stückes werden Paul und Mutter Fent nach rücksichtslosem Verhör durch den ermittelnden Kommissar abgeführt, während das sterbende Mädchen allein in seinem Zimmer zurückbleiben muss.
III Online-Ausgabe
Eine Printversion des Schauspiels kann unentgeltlich und in voller Länge im Onlinearchiv Nemesis - Sozialistisches Archiv für Belletristik nachgelesen werden. Dieses Onlinearchiv hat (Zitat): das Ziel, die schwer erhältlichen, sozialistischen Schriften der Vergangenheit einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Alle Dokumente sind heute kaum noch zugänglich oder meist nur gegen viel Geld zu erwerben. Das Archiv jedoch ist kostenlos.
IV Filmadaption 1930 und Zensur
Der österreichische Filmregisseur Hans Tintner verfilmte das Stück 1930 mit Grete Mosheim für die Atlantis-Film, doch wurde der Film erst nach der Umsetzung zahlreicher Schnittvorgaben für die Kinos freigegeben. Im Februar 1931 wurde Friedrich Wolf zusammen mit der Ärztin Else Kienle kurzzeitig in „Schutzhaft“ genommen und der gewerbsmäßigen Abtreibung beschuldigt. Beide kamen jedoch nach Massenprotesten wieder frei.
Siehe zur Verfilmung von 1930 auch Wikipedia und die Filmbeschreibung auf filmportal.de.
Aus diesem Filmportal ist die Verlinkung auf die Zensurentscheidung vom 29.08.1930 mit dem Verbot und die Zulassungsentscheidung vom 12.12.1930 entnommen, aus der man sieht, welche "grundlegende" Veränderungen der "Bildstreifen" erfahren hat, um die Zulassung zu erhalten.
Siehe zur Filmbeschreibung und zu Zensur und Verbot auch die Veröffentlichung von Jochen Kürten vom 20.11.2016 unter dem Titel Zensiert und verboten: Cyankali auf der Webseite des Medienunternehmens Deutsche Welle.
V Filmadaption 1977
1977 kam es im Fernsehen der DDR zu einer Studioaufzeichnung des Schauspiels Cyankali unter der Regie von Jurij Kramer, die am 15.09.1977 (nach anderen Quellen: 15.11.1977) im ersten Programm des Fernsehens der DDR gezeigt wurde, siehe Wikipedia und Fernsehen der DDR -Online.
Das Ferssehspiel wurde zuletzt vom MDR am 28.07.2022 ausgestrahlt, siehe Beschreibung.
Die 2016 erschienene und auf der Webseite Kultur-online des Vereines artCore beschriebene Doppel-DVD ist vergriffen.
VI Kommentar
Kerstin Wilhelms erwähnt in Das deutschsprachige Gerichtsdrama, in: Thomas Gutmann, Eberhard Ortland, Klaus Stierstorfer (Hgg.), Enzyklopädie Recht und Literatur (2022) im Kapitel 4. Gerichtsdramen des 20. Jahrhunderts (Zitat):
Im 20. Jahrhundert erlebt das Gerichtsdrama in Deutschland einen regelrechten Boom. In der Weimarer Republik hat das Gerichtstheater als Zeitstück Konjunktur: Aktuelle und öffentlichkeitswirksame Gerichtsprozesse werden im Theater neu aufgerollt, meist mit dem Ziel einer Justizkritik. Bekannteste Werke sind hier Cyankali von Friedrich Wolf (1929) und ...
Der gesamte Aufsatz, aus dem das Zitat stammt, ist hier unter der Creative Commons Lizenz CC BY ND abrufbar.
VII Hinweise zu dieser Webseite
- Die Zitate aus dem Begleittext zur Hörfunksendung des WDR, aus der freien Enzyklopädie Wikipedia zu den Abschnitten II, IV und V, aus dem Onlinearchiv Nemesis, aus dem Filmportal (samt Verlinkung auf die beiden Zensurentscheidungen), aus der Deutschen Welle, aus Fernsehen der DDR-Online, aus Kultur-Online und aus dem Aufsatz Das deutschsprachige Gerichtsdrama (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellen) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.
- Auf die Möglichkeit, den Hörfünkbeitrag der Reihe Zeitzeichen auf der Webseite des WDR unentgeltlich zu hören und eine Printversion des Schauspiels Cyankali unentgeltlich und in voller Länge im Onlinearchiv Nemesis zu lesen, wurde hingewiesen.
- Personenbezogene Daten ergeben sich aus den Schauspiel- und Filmbeschreibungen sowie aus der Geschichte.
