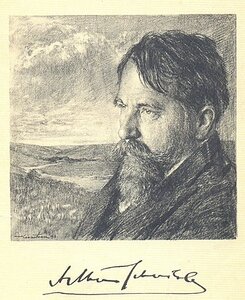I Der Prozess um Schnitzler's Reigen - Hörspiel von Rainer Lewandowski - NDR 1980
Der unter III beschriebene Reigen-Prozess und die von Wolfgang Heine im Verlag von Ernst Rowohlt herausgebrachten stenographischen Protokolle des Prozesses waren der Ausgangspunkt für die Hörspielproduktion des NDR 1980 unter dem Titel Der Prozess um Schnitzler's Reigen und unter der Regie von Rainer Lewandowski. In der Beschreibung zu diesem Hörspiel ist festgehalten (Zitat):
Der Prozess um die Aufführung von Schnitzlers „Reigen“ in Berlin vom 5. bis zum 12. November 1921 zählt zu den größten Literaturskandalen der Weimarer Republik. Der Prozess ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam und aktuell geblieben, er veranschaulicht packend, wie die Deutschnationalen ihren bornierten und judenfeindlichen Kulturbegriff durchzusetzen versuchten und legt das philisterhafte Denken deutscher „Anstoßnehmer“ offen, denen es unter dem Deckmantel des Schutzes der Jugend um die Verbreitung ihrer privaten Moral- und Wertvorstellungen geht.
Das Hörspiel basiert auf den 450 Seiten des Protokolls dieser Verhandlung, wobei die Zahl der Teilnehmer reduziert wurde, aber innerhalb der Aussagen wurde vom Verfasser nichts hinzugesetzt.Kammervorsitzender - Werner Rundshagen | Staatsanwalt - Harald Pages | Verteidiger - Heiner Schmidt | Gertrud Eisoldt - Rosemarie Wohlbauer | Maximilian Sladek - Harry Riebauer | Robert Forster-Larrinaga - Rüdiger Schulzki | Dr. Alfred Kerr - Horst Keitel
II Online Ausgabe des Hörspiels
Die Hörspielversion Der Prozess um Schnitzler's Reigen des NDR aus 1980 kann aus den 1499 Aufnahmen der akustischen Bibliothek (Hörspiele, Features, Vorträge) im Internetarchiv ausgewählt werden,
dort (unentgeltlich) gehört werden
und wurde daher für die Website Favorartis ausgewähllt und gemäß dem Datum der Sendung, dem Produzenten NDR und dem Ort des Prozesses der BRD zugeordnet.
III Der Reigen-Prozess
Übernommen aus Wikipedia
Nach der Uraufführung in Berlin wurden die beiden Direktoren des Kleinen Schauspielhauses, Maximilian Sladek und Gertrud Eysoldt, der Regisseur Hubert Reusch sowie die Darsteller Elvira Bach, Fritz Kampers, Vera Skidelsky, Victor Schwanneke, Robert Forster-Larrinaga, Blanche Dergan, Tillo, Madeleine, Rieß-Sulzer, Delius und Copony wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vor Gericht gestellt. Der Prozess fand vom 5. bis 18. November 1921 in Berlin statt. Die Verteidigung hatte der Rechtsanwalt und ehemalige sozialdemokratische Minister Wolfgang Heine übernommen, der im Anschluss die stenographischen Protokolle des Prozesses im Verlag von Ernst Rowohlt herausbrachte.
Zeugen kritisierten eine Verherrlichung des Ehebruchs, nahmen Anstoß an der Aussprache über die nervösen Störungen des jungen Mannes oder kritisierten etwa, dass der Rhythmus der Musik während des Fallens des Vorhangs Beischlafbewegungen wiedergegeben habe. Die Zeugen stammen zum Teil aus (22) Organisationen wie etwa der deutschen evangelischen Kirche, einem Studentenverband, der Bahnhofsmission oder dem Volksbund für Anstand und gute Sitte. Vernommen wurde auch Prof. Brunner, ein Beamter im Polizeipräsidium und Kämpfer gegen Schundliteratur, der "Belastungszeugen" Gratiskarten beschaffte. Aus diesem Grunde haben "Entlastungszeugen" von einem Hetzsystem gesprochen.
Nach fünftägiger Verhandlung, bei der auch zahlreiche angesehene Literaturwissenschaftler, Theaterleute und Publizisten gehört wurden, erfolgten Freisprüche, da die Aufführung in keiner Weise obszön oder anstößig gewesen sei. In der Urteilsbegründung hieß es ua (Zitat):
„Das Stück verfolgt, wie das Gericht aus der Beweisaufnahme feststellt, einen sittlichen Gedanken. Der Dichter will darauf hinweisen, wie schal und falsch das Liebesleben sich abspielt. Er hat nach Auffassung des Gerichts, nicht die Absicht gehabt. Lüsternheit zu erwecken. […] Die Sprache des Buches ist fein und leicht. Die Charaktere werden mit wenigen scharfen Strichen vorzüglich gezeichnet. Die dramatischen Verwicklungen sind mit psychologischer Feinheit entwickelt. Die Handlung wird in jedem Bilde bis unmittelbar vor den Beischlaf durchgeführt, der in dem Buche durch Gedankenstriche angedeutet wird. Darauf setzt die Handlung wieder ein, die die Wirkung des geschlechtlichen Rausches skizziert. Die geschlechtliche Beiwohnung selbst wird nicht beschrieben. Sie tritt vollkommen zurück, sie ist dem Dichter nur Mittel zum Zweck.“
Der Prozess fand ein großes Echo in literarischen und künstlerischen Kreisen, denn es ging dabei nicht nur darum, ob es sich beim Reigen um Kunst oder Unmoral handele, sondern letzten Endes auch um die politische Frage, ob der Staat der Kunst Vorschriften machen dürfe. Als der Prozess mit Freispruch endete, wurde ein für das fortschrittliche Theater der 1920er Jahre wichtiger Präzedenzfall geschaffen.
IV Reigen - Drama von Arthur Schnitzler - Erstaufführung 1920
Reigen ist das erfolgreichste Bühnenstück von Arthur Schnitzler. Es schildert in zehn erotischen Dialogen die unerbittliche Mechanik des Beischlafs (der im Stück selbst nicht gezeigt wird) und sein Umfeld von Macht, Verführung, Sehnsucht, Enttäuschung und das Verlangen nach Liebe. Es zeichnet ein Bild der Moral in der Gesellschaft des Fin de siècle und durchwandert dabei in einem Reigen alle sozialen Schichten vom Proletariat bis zur Aristokratie.
Schnitzler schrieb die erste Fassung zwischen 23. November 1896 und 24. Februar 1897. 1903 wurde es im Wiener Verlag von Fritz Freund veröffentlicht und zu einem Bestseller. Die erste vollständige Aufführung mit Zustimmung des Autors erfolgte am 23. Dezember 1920 am Kleinen Schauspielhaus in Berlin und war einer der größten Theaterskandale des 20. Jahrhunderts. Auch in Wien wenige Monate später kam es zum Skandal. In Berlin kam es zum so genannten Reigen-Prozess, nach dem Schnitzler ein Aufführungsverbot für das Stück verhängte, das bis zum 1. Januar 1982 in Kraft war.
Siehe dazu mehr im Wikipedia-Eintrag zu Reigen (Drama).
V Handlung des Dramas
Zehn Personen begegnen einander in Paaren, sie führen zehn Dialoge und jedes Mal findet das Paar dabei zu sexueller Vereinigung. Als Strukturprinzip verwendet Schnitzler die Tanzform des Reigens, indem eine Figur immer die Hand einer neuen Figur für die nächsten Szene reicht. Schnitzler beschreibt aber nur die Situationen vor und nach dem Koitus, der Geschlechtsverkehr selbst wird nicht gezeigt, er ist im Text mit Gedankenstrichen nur angedeutet. Nach jeder Szene wird ein Partner ausgetauscht und dabei die gesellschaftliche Leiter erstiegen, von Dirne, Soldat und Stubenmädchen über junger Herr, Ehefrau, Ehemann und süßes Mädel bis zum Dichter, der Schauspielerin und dem Grafen, der am Schluss wieder mit der Dirne zusammentrifft und so den Reigen schließt. Siehe dazu mehr im Wikipedia-Eintrag zu Reigen (Drama) mit der Kurzbeschreibung der zehn Dialoge.
VI Buch- und Onlineausgaben des Dramas
Buchausgaben sind ua im Reclam Verlag 2008 unter dem Titel Reigen, Zehn Dialoge, ISBN 978-3-15-018158-4 und im Verlag S. Fischer, 2004unter dem Titel Ein Liebesreigen. Die Urfassung des «Reigens», ISBN 3-10-073561-7 erschienen.
Online Ausgaben sind im Projekt Gutenberg DE und in der Volltextbibliothek Zeno.org kostenlos zu lesen.
VII Verfilmungen, Schallplattenaufnahmen, Hörspiele und Parodie des Dramas
Nicht zuletzt wegen des Bühnenaufführungsverbotes (bis 1982) kam es zahlreichen Adaptionen: hervorgehoben seien die drei Verfilmungen 1950 La Ronde von Max Ophüls, 1964 La Ronde von Roger Vadim und 1973 Reigen von Otto Schenk, die Schallplattenaufnahme 1966 Reigen von Gustav Manker, das Hörspiel 1981 Reigen von Peter M. Preissler und die kabarrettisitische Parodie 1951 Reigen 51 von Qualtinger/Kehlmann/Merz und deren Verfilmung 1963 Das große Liebesspiel von Alfred Weidemann, siehe dazu mehr und Verlinkungen im Wikipedia-Eintrag Reigen (Drama).
VIII Kommentare
In der Hörfunksendung ZeitZeichen vom 23.12.2020 erinnert der WDR an die Uraufführung von Schnitzler's Reigen vor genau 100 Jahren und an den darauffolgenden Prozess.
Im Kommentar in der Wiener Zeitung vom 17.10.2021 unter dem Titel Schnitzlers Bühnen- und Lebenstragödie wird ebenfalls an den Prozess vor 100 Jahren erinnert und ua ausgeführt, dass (Zitat)
- sein Episodenstück "Reigen", das er gegen Ende des fin de siècle verfasst und nur als Privatdruck verteilt hatte, in den jungen Republiken Deutschland und Österreich ab Dezember 1920 auf die Bühne kam und klerikale und nationale Kreise auf die Barrikaden brachte,
- es nach dem "Schmutz- und Schundgesetz" in Berlin zur Anklage von Regie und Darstellern kam,
- die Zeugen, wie der Strafverteidiger und Politiker Wolfgang Heine in einer 1922 erschienenen Dokumentation nachwies, durchwegs Schein-Zitate wiedergaben, die auf der Bühne nie gesagt worden waren, und sie Szenen schilderten, die sie nur vom Hörensagen kannten, erahnt oder geträumt hatten und
- es auch einen Wiener Prozess gab ...: Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Jakob Reumann musste sich vor dem Verfassungsgerichtshof verantworten, weil er die "Reigen-Aufführung" trotz Anordnung des Innenministers Waber nicht untersagt hatte. Reumann wurde aber freigesprochen, da unklar war, ob die Weisung korrekt zustande kam. Hinter dem Freispruch stand auch Hans Kelsen, damals Verfassungsrichter, der den Missbrauch der staatsrechtlichen Anklage erkannt hatte.
Im Jahre 1952 gab es einen weiteren Prozess in Wien: in Abschnitt IV dieser Webseite wird auf die kabarrettisitische Parodie 1951 Reigen 51 von Qualtinger/Kehlmann/Merz hingewiesen, hiezu sei die Entscheidung des LG Wien 27 Cg 292/52 in Erinnerung gerufen - siehe Abschnitt IX der Webseite Parodie
IX Hinweise zu dieser Webseite
- Die Zitate aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (zu Reigen (Drama)), aus den Webseiten der Wiener Zeitung (zu Schnitzlers Bühnen- und Lebenstragödie) und des WDR (zur Sendung ZeitZeichen) sowie aus der Beschreibung des Hörspiels Der Prozess um Schnitzler's Reigen im Internetarchiv (mit den jeweils aus der Verlinkung ersichtlichen Quellenangaben) erfolgen im angeführten Umfang zur Erläuterung des Inhaltes der Webseite.
- Auf die Möglichkeit, die Textausgabe des Dramas auf Gutenberg DE und Zeno.org zu lesen und das Hörspiel im Internetarchiv zu hören, wurde hingewiesen.
- Personenbezogene Daten ergeben sich aus der Literaturbeschreibung sowie aus dem Bekanntheitsgrad der Autoren und ihrer Werke.